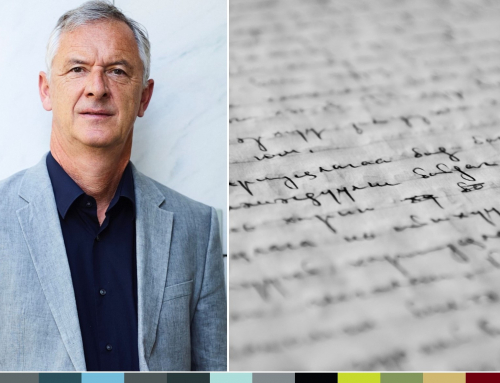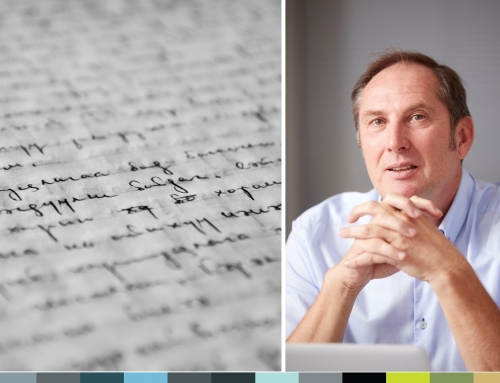Die Coronakrise hat zu einem nahezu weltweiten Stopp des bisherigen Alltagslebens geführt. Neben all der Unsicherheits-, Panik- oder aber Beschwichtigungs- und Abwehrreaktionen bersten die Medien (neu wie alt) vor Hinweisen auf nun „besonders gefährdete“ Gruppen in der Situation der verordneten Vereinzelung im Privaten: Frauen in Beziehungen mit gewaltbereiten Partnern; Kinder in prekären engen Wohnräumen mit überforderten Eltern oder dem Zugriff von Kinderschändern noch unmittelbarer ausgesetzt; ältere Menschen in noch stärkerer Isolation und Vereinsamung; oder Obdachlose ohne Zugang zu öffentlichen Räumen und Ressourcen, da weder Betteln (leere Straßen) noch Essen oder Aufwärmen (geschlossene Tafeln und Einrichtungen) möglich sind.
All dies war auch vor der Coronokrise schon immer die Lebenswirklichkeit für einen Teil unserer Gesellschaft. Und ja, wir wussten davon, aber so war eben die Welt und so haben wir die große Not vieler Menschen als unabänderlich hingenommen. Der verordnete Stopp lässt uns inne zu halten, bricht mit unserer Normalität. Vielleicht ist es dieses merkwürdig ungewohnte Gefühl von Verletzlichkeit, das durch das Wegbrechen des Alltags entsteht und es nun erlaubt, unseren Blick zu weiten und wie mit einem Brennglas auf die Lebenswirklichkeit dieser Menschen zu richten? Deren Situation mag in einigen Fällen tatsächlich schlimmer sein als vor der Coronakrise, aber ihre grundsätzliche Not war davor schon da.
Nutzen wir die Krise dazu, unseren erweiterten Blick auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse beizubehalten. Auch dann, wenn alles wieder „hochgefahren“ wird und wir irgendwann wieder in einer „Normalität“ gelandet sind. Die Erfahrung der Verletzlichkeit, die dadurch entsteht, dass der Alltag wegbricht, ist etwas, das wir alle nun mit der Erfahrung jener besonders gefährdeten Menschen teilen. Diese Verletzlichkeit ist ihre Alltagserfahrung – vor, während und vermutlich auch nach Corona. Es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, den Anteil jener Menschen, die in solchen verletzlichen/prekären Verhältnissen leben müssen, so gering wie möglich zu halten. Dazu bedarf es eines Umbaus unserer Gesellschaft. Vielleicht gelingt es uns, die Erfahrungen unserer eigenen Verletzlichkeit in die Zeit nach Corona zu bewahren und verantwortungsvoll an der Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft mitzubauen.
Heike Egner, Ida Pfeiffer Professorin an der Universität Wien, Sozionautin und Vorstandsmitglied des Universitäts.club|Wissenschaftsverein Kärnten
21. April 2020